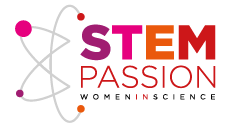MARIA SCHÖNBÄCHLER

Photo: Prof. Dr. Maria Schönbächler, Full Professor at the Department of Earth and Planetary Sciences and Deputy head of Institute of Geochemistry and Petrology, ETH, Zurich, 2025. ©Elisabetta Citterio 2025.
STAY TRUE TO YOURSELF. SPARK YOUR JOURNEY IN SCIENCE.
Maria Schönbächler is a Full Professor at the Department of Earth and Planetary Sciences in ETH Zurich and Deputy Head of the Institute of Geochemistry and Petrology.
A leading expert in isotope cosmochemistry, her pioneering research on meteorites has significantly deepened our understanding of the formation and evolution of the Solar System and Earth. By analyzing the chemical and isotopic composition of meteorites and extraterrestrial samples returned by space missions, she and her team investigate the early history of our planetary system, revealing key insights into major events like the formation of the Earth, the origin of the Moon, and the emergence of the first continents.
Their work is carried out in ETH Zurich’s geochemistry laboratory, one of the world’s most advanced of its type, where they also develop new analytical techniques and instruments.
In 2022/2023, she gained public recognition for discovering five new meteorites during an Antarctic expedition, including a rare 7.6 kg specimen.
As of January 2025, she serves as Vice-President of the Meteoritical Society, which awarded her the inaugural Jessberger Award in 2021 for her outstanding contribution to isotope cosmochemistry.
Maria Schönbächler is a Full Professor at the Department of Earth and Planetary Sciences at ETH Zurich and Deputy Head of the Institute of Geochemistry and Petrology.
She is a leading figure in modern isotope cosmochemistry. Her innovative analytical work on isotopic variations in meteorites has significantly advanced our understanding of early Solar System processes.
Growing up outside of academia, she initially worked for the Swiss postal service while attending evening classes, with the goal of eventually entering university. Choosing passion over job security, she went on to study Earth Sciences at ETH Zurich, inspired by lectures in Planetology. A graduate project on meteorites offered by Professor Alex Halliday sparked her lasting fascination with how matter, stars, and planets formed.
She conducted her doctoral research on zirconium isotopes and their implications for the formation of the solar system, followed by postdoctoral work on silver isotopes and Earth’s formation at the Carnegie Institution for Science in Washington DC, USA, and at Imperial College London. She then held faculty positions at the University of Manchester before returning to ETH Zurich in 2012.
Traveling to different countries has enhanced her awareness of cultural differences. Time spent at the Natural History Museum in Paris deepened her appreciation for meteorite curation. During the 2022/2023 austral summer, she participated in a Belgian-led Antarctic expedition to locate new meteorite-rich areas near the Princess Elisabeth research station. On that occasion, the international research team returned with five newly discovered meteorites, including one weighing 7.6 kg (16.7 pounds), highlighting Antarctica’s remarkable potential for meteorite hunting.
Her primary area of investigation is the origin and evolution of our Solar System and in particular of our planet Earth. This includes the formation of the Sun and planets from the solar nebula – a rotating disk of gas and dust surrounding the young Sun – as well as the Earth’s early evolution, including core formation, the creation of the Moon, and the emergence of the first continents.
She investigates these topics primarily through geochemical tools, comparing elemental and isotopic abundances in different samples, like meteorites and extraterrestrial samples returned by space missions. This work relies on advanced mass spectrometers and clean-room laboratories. ETH Zurich hosts one of the world’s leading isotope geochemistry laboratories, where both stable and radioactive isotopes, as well as noble gases, are analyzed. The lab also plays a key role in developing and new analytical methods and instruments.
Throughout her career, she has gained valuable experience working with various scientific organizations. In addition to her roles at ETH Zurich, she was a council member of the European Association of Geochemistry (2013–2015) and served on the executive board of the Swiss Academy of Sciences (2016–2022). She has also held the position of Vice President of the Swiss National Science Foundation’s foundation council (with her term ending in December 2023). As of January 2025, she serves as Vice-President of the Meteoritical Society, which honored her with the inaugural Jessberger Award in 2021 as a recognition of her outstanding research in isotope cosmochemistry.
In her words: “I decided that when choosing my career, interest- not job security -should be my top priority.”
Keywords: Geowissenschaften, Sonnensystem, Planet Erde, Planeten, Meteoriten, Chondriten, Mondentstehung, archäische Gesteine, Asteroideneinschläge, Geochemie, Geophysik, Astronomie, Astrophysik und Weltraumwissenschaften, Isotopengeochemie, Kosmochemie, Anorganische Chemie, Organische Chemie, Technische Physik, Klimatologie, Atmosphärenchemie, Aeronomie, Geochronologie
Zurich – May 13th, 2025
When did you first get interested in science? I didn’t discover science right away. As a child, I did not dream of becoming a scientist. Growing up in a small village with little exposure to science or scientists, it simply wasn’t part of my world. There was one professor living in the village, but I didn’t think I was clever enough for that kind of life – it felt so far from the world I grew up in, surrounded by farmers and everyday working people. Scientists seemed to belong to a completely different world. Like most people in Switzerland, I began with an apprenticeship – mine was at a post office, inspired by my parents who were running the local post office. After a while, I started looking for a new challenge, even though I wasn’t exactly sure what direction to take. Eventually, I decided to go back to school and earn my Matura, which is necessary to attend university in Switzerland. During those studies, I was introduced to subjects like math, physics, chemistry, geology, and biology – and I really enjoyed them. That’s what led me to study geology at university, because you can do all these topics in a geology degree program. Even then, pursuing a PhD wasn’t part of the plan; it was something I discovered along the way. Toward the end of my degree, a new professor introduced a research project in cosmochemistry, focusing on meteorites and asteroids. I found it fascinating and decided to apply. When I was accepted, I began my PhD and quickly realized how much I loved research and the thrill of discovery. After completing my PhD, I pursued postdoctoral research abroad. I first went to the U.S. to work at the Carnegie Institution, which was an invaluable experience. Then, I moved to the U.K. for another postdoc position, before securing my first faculty role in Manchester. About ten years ago, I returned to Switzerland. Along this journey, I came to realize that my true calling as a scientist stems from a deep passion for research and discovery. I discovered it step by step, really. My inspiration didn’t come from a person or a defining moment – it was the subjects themselves, unfolding one by one, that sparked my interest. It has always been a curiosity-driven journey and still is as a scientist.
What drives and excites you the most in your work? I work in planetary science, and I’m simply fascinated by planets. I can’t really explain why, it’s just a part of who I am. At the same time, I’ve always loved science. What truly drives me is the thrill of discovery: exploring new questions, facing new challenges, and making progress, step by step. There’s something incredibly exciting about diving into the unknown and learning something no one knew before.
And the most exciting moment in recent years? In science, progress often comes through many small steps, and for me it’s exactly those moments that are the most meaningful. One of the most exciting periods was during my postdoc. It was a challenging time; I was working hard to get an analytical technique up and running so I could finally start measuring meteorites and move the research forward. When it finally worked, and I published my first paper in the highly rated journal “Science”, which was truly based on my own ideas and work. That was a really special moment. Being recognized for even a small step forward felt incredibly rewarding. But that kind of recognition isn’t what drives me most. What truly motivates me is the process of discovery – uncovering new questions, exploring new directions, and making meaningful contributions to the field, even in small ways. As a scientist, you’re constantly learning: first by understanding what’s already known, and then by asking how we can push those boundaries and support further progress. That continuous journey is what I find most exciting.
The most exciting discovery? That’s a tough question, but one moment that stands out is a paper we published modeling how and when water – and other volatile elements – arrived on Earth. Our research showed that most of Earth’s water was already present during its formation, locked inside the planet as it grew. As Earth cooled, the water gradually degassed, forming an atmosphere, the oceans and setting the stage for life. The idea that the ingredients for life were part of Earth from the very beginning was incredibly exciting to me.
Do you have any advice or words of encouragement for other women, particularly those aspiring to become scientists? It’s important to do something you love. Your passion should come from within. Don’t pursue science to meet others’ expectations; do it for yourself. Science can be tough, and you will face challenges. But if you stay open-minded and persistent, you’ll often discover new paths – sometimes even more exciting than what you first imagined. It’s just as important to recognize limits and remain flexible enough to find the unexpected doors that might lead you further. Being a scientist is more than just a job. It’s something you have to feel passionate about, because while it’s not a “normal” job, it’s incredibly rewarding – if it’s the right fit for you. Sometimes students or postdocs want to stay in science but also want to remain in Switzerland, and that can be difficult – there simply aren’t that many positions available. Luckily, there are many different ways to be involved in science, all of them can be fulfilling. There are more opportunities out there than you might think.
Are women in science extraordinary women? To be honest, I don’t think so. They’re just regular women doing what they love. Women in science could just as well be entrepreneurs, journalists, zookeepers, or anything else – the possibilities are endless. What really matters is passion. These women are passionate about science, and that passion is what drives them. But they’re not fundamentally different from anyone else pursuing what they care about.
What do you think is the main reason behind the underrepresentation of women in science? That’s a very difficult and complex topic – which is why it hasn’t been fully solved yet, and we still need to keep working on it. I believe much of it comes down to societal norms and long-standing traditions. We’ve made important progress in recognizing women as equals to men, but many of us, myself included, grew up in environments where traditional roles were still the norm – men working outside the home, women mostly taking care of children and the household. At the societal level – particularly in countries like Switzerland – traditional roles remain deeply rooted, and stepping outside them can be challenging. For many raised with traditional views of motherhood, choosing daycare can feel like a difficult shift, even when confident their child is well cared for and socializing. I believe society needs to recognize that there are many valid ways to live a fulfilling life, and that children and future generations can thrive in families that don’t necessarily follow traditional roles. It’s about embracing diversity in how we live and work, and letting go of outdated expectations.
What about the new generation? Is something changing? In Switzerland, I see both progress and challenges. My generation pushed for change – some of my friends, for example, had husbands who stayed home while they were at work – showing that what matters most is finding what works best for each family. Yet many people still struggle to balance careers and children. Access to childcare access is a major hurdle. Although men have made progress in sharing responsibilities, childcare duties still tend to fall mainly on women, who often feel the greater burden. Society must keep evolving by embracing diverse ways of living and working, shifting the focus from traditional roles on creating a system of support for families.
What does success mean to you? How do you define personal success in your job or in life? I think success really depends on what’s important to you personally and how well you’re able to live according to that. While I’ve reflected critically on traditional roles, I also recognize that for many people, having a family and focusing on that role is both fulfilling and challenging – and they find true happiness and success in it. For me, success is about what satisfies you as an individual. Sure, society often places greater value on certain roles, like being a professor, but that shouldn’t be the definition of success. Real success is whether I can live the life I want to live.
What efforts and sacrifices do you make in doing science? I work long hours – so many that I don’t even keep track of them. But when you’re driven by passion and feel energized by your work, that’s absolutely fine. The key is finding satisfaction and balance, though that balance is very personal and different for everyone. That’s one of the challenges today, especially for the younger generation: with so many options, it’s not always easy to find where you truly fit. When I was twenty, I wasn’t exactly sure what my talents or needs were either. You have to explore, try things out, and sometimes fail to realize what is right for you, and that’s okay. In fact, failure is part of success.
In your view, what are the biggest challenges for the next generation of women scientists? The next generation of women scientists faces many challenges. Although progress has been made toward equality, unconscious biases still exist. In the past, women had to work harder to gain recognition, even if this wasn’t always openly acknowledged. Achieving a fair and inclusive environment means ensuring women make up about 30-40% of the scientific community. Below that threshold, women tend to be seen as minorities and as women; at or above it, they’re recognized as equal members and as scientists. Many institutions now prioritize hiring qualified women, which can sometimes cause frustration among men competing for limited positions. It’s crucial to address these inequalities thoughtfully without creating unfairness for any gender. After years of bias, supporting women is justified, but pushing too hard risks backlash.
Does gender diversity matter to you in your scientific work? What value do you see in diversity within science? For me, it’s about diversity in general. Diversity brings a wider range of viewpoints, which ultimately improves the quality of science. When you’re not stuck in your own small corner, you gain a broader perspective. At the same time, diversity can bring challenges – cultural differences, generational gaps, gender perspectives – and it requires effort to bring everyone onto the same page. This process is really about respect: respecting differences and valuing each person’s unique perspective. I truly believe diversity is a gain. Studies show that deep diversity leads to better outcomes, and I see that reflected in scientific work as well.
Do men and women bring different perspectives or sensitivities to scientific work? I think there are some gender-related differences, but it’s hard to generalize at the individual level. Statistically, women often work quietly without self-promotion, which can be a disadvantage in science. They also tend to focus more on teamwork. Of course, exceptions exist for both women and men. When I led a national gender program, I encountered a lot of discomfort around being classified into stereotypes. No one fits neatly into categories, and it’s important to acknowledge the broad diversity within a group. In the end, it’s best to consider these differences as statistically tendencies and to focus on data, avoiding broad generalization.
What is your opinion on diversity & inclusion programs and their effectiveness? We’re not there yet – at least not in Switzerland. Real change will take another 10 to 20 years, and I remain cautiously optimistic, but only if we keep working on it. Sometimes people think, “We’ve hired a few women professors, so the problem is solved.” But that’s not true. Progress can easily stall. We still see patterns where women hesitate to apply for positions unless they meet 100% of the criteria, while men often apply when meeting only 80%. These differences matter. That’s why gender and diversity programs are still necessary. They help maintain awareness high and ensure we continue moving forward, not backwards.
What are your thoughts on intersectional stereotypes? Unconscious bias often starts with gender, but it becomes more complex when other aspects of identity intersect – like being a woman, black, from a different religion, or being an international student in Switzerland. Each additional layer can increase the challenges, especially when you’re part of multiple minority groups. But confidence is key. Believing in yourself and your right to be where you are – because of your education and merit – can make it easier to face challenges and ignore those who question you. Of course, that’s easier said than done, but confidence can act as a kind of protection.
Foto: Prof. Dr. Maria Schönbächler ©Elisabetta Citterio 2025
Bleib dir selbst treu. Entfache das Feuer deiner persönlichen Reise in die Wissenschaft.
Maria Schönbächler ist ordentliche Professorin am Departement für Erd- und Planetenwissenschaften und stellvertretende Leiterin des Instituts für Geochemie und Petrologie an der ETH Zürich.
Sie ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der Isotopen-Kosmochemie. Ihre innovative Forschung an Meteoriten hat unser Verständnis über die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems und der Erde grundlegend erweitert.
Aufgewachsen ausserhalb eines akademischen Umfelds, arbeitete sie zunächst bei der Schweizer Post und besuchte gleichzeitig Abendkurse, mit dem Ziel, später an einer Universität zu studieren. Sie entschied sich bewusst für ihre Leidenschaft und gegen die Sicherheit eines festen Jobs und begann das Studium der Erdwissenschaften an der ETH Zürich, inspiriert durch Vorlesungen in Planetologie. Ein Doktorat über Meteoriten, angeboten von Professor Alex Halliday, entfachte ihre anhaltende Faszination für die Entstehung von Materie, Sternen und Planeten.
Ihre Doktorarbeit widmete sie der Analyse von Zirkoniumisotopen und was diese über die Entstehung des Sonnensystems verraten. Anschliessend forschte sie als Postdoktorandin über Silberisotope und die Entstehung der Erde an der Carnegie Institution for Science in Washington D.C., USA, sowie am Imperial College London. Danach hatte sie eine akademische Stelle an der University of Manchester (GB) inne, bevor sie 2012 als Professorin an die ETH Zürich zurückkehrte.
Aufenthalte in verschiedenen Ländern haben ihr Bewusstsein für kulturelle Unterschiede geschärft. Ihre Zeit an dem Naturkundemuseum in Paris vertiefte ihre Wertschätzung für die Meteoriten-Kuration. Während des antarktischen Sommers 2022/2023 nahm sie an einer Expedition unter belgischer Leitung in der Antarktis teil, um neue meteoritenreiche Gebiete in der Nähe der Forschungsstation Princess Elisabeth zu suchen. Dabei brachte das internationale Forschungsteam fünf neu entdeckte Meteoriten zurück, darunter ein 7,6 kg schweres Exemplar – ein Beweis für das aussergewöhnliche Potenzial der Antarktis zur Meteoritensuche.
Ihr zentrales Forschungsgebiet ist der Ursprung und die Entwicklung unseres Sonnensystems, insbesondere unseres Planeten Erde. Dies umfasst die Entstehung der Sonne und der Planeten aus der solaren Urwolke – einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub um die junge Sonne – sowie die frühe Erdgeschichte, einschliesslich der Kernbildung, der Entstehung des Mondes und der Bildung der ersten Kontinente.
Sie erforscht diese Themen hauptsächlich mit geochemischen Methoden, indem sie Element- und Isotopenverhältnisse in verschiedenen Proben wie Meteoriten und weiterem extraterrestrischem Material – zurückgebracht von Raumfahrtmissionen- vergleicht. Diese Arbeit erfordert hochmoderne Massenspektrometer und Reinraumlabore. Die ETH Zürich beherbergt eines der weltweit führenden Labore für Isotopengeochemie, in dem sowohl stabile als auch radioaktive Isotope sowie Edelgase analysiert werden. Das Labor spielt auch eine zentrale Rolle bei der Entwicklung neuer analytischer Methoden und Instrumente.
Im Laufe ihrer Karriere hat sie wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen wissenschaftlichen Organisationen gesammelt. Neben ihren Aufgaben an der ETH Zürich war sie Mitglied des Vorstands der European Association of Geochemistry (2013–2015) und der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (2016–2022). Zudem war sie Vizepräsidentin des Stiftungsrats des Schweizerischen Nationalfonds (bis Dezember 2023). Seit Januar 2025 ist sie Vizepräsidentin der Meteoritical Society, die sie 2021 mit dem ersten Jessberger Award für ihre herausragende Forschung in der Isotopen-Kosmochemie auszeichnete.
In ihren Worten: „Ich habe entschieden, dass bei der Berufswahl das Interesse – und nicht die Jobsicherheit – an erster Stelle stehen sollte.“
Stichwörter: Earth Sciences, Solar System, Planet Earth, Planets, meteorites, chondrite, moon formation, Archean rocks, asteroid impacts, Geochemistry, Geophysics, Astronomy, Astrophysics and Space Science, Isotope geochemistry, Cosmochemisty, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Technical Physics, Climatology, Atmospherical Chemistry, Aeronomy, Geochronology
Zürich – 13. Mai 2025
Wann hast du dich zum ersten Mal für Wissenschaft interessiert? Ich habe die Wissenschaft nicht sofort für mich entdeckt. Als Kind habe ich nie davon geträumt, Wissenschaftlerin zu werden. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo es kaum Berührungspunkte mit Wissenschaft oder Wissenschaftlern gab – das gehörte einfach nicht zu meiner Welt. Es lebte zwar ein Professor im Dorf, aber ich dachte, dass ich nicht klug genug für so ein Leben wäre – es wirkte so weit entfernt von der Welt, in der ich aufgewachsen bin, umgeben von Landwirten und Leuten in alltäglichen Berufen. Wissenschaftler schienen einer völlig anderen Welt anzugehören. Wie die meisten in der Schweiz habe ich mit einer Lehre begonnen – meine war bei der Post, inspiriert von meinen Eltern, die die Poststelle im Dorf betrieben. Nach einer Weile suchte ich nach einer neuen Herausforderung, auch wenn ich nicht genau wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Schliesslich entschied ich mich, wieder zur Schule zu gehen und die Matura nachzuholen, die in der Schweiz notwendig ist, um an die Universität zu gehen.Während dieses Studiums kam ich zum ersten Mal mit Fächern wie Mathematik, Physik, Chemie, Geologie und Biologie in Berührung – und sie haben mir wirklich Spass gemacht. Das brachte mich dazu, Geologie an der Universität zu studieren, da sind alle diese Fächer mit dabei. Selbst da war ein Doktorat nicht Teil meines Plans – das habe ich erst später auf meinem Weg entdeckt. Gegen Ende meines Studiums stellte ein neuer Professor ein Forschungsprojekt in der Kosmochemie vor, mit dem Schwerpunkt auf Meteoriten und Asteroiden. Ich fand das faszinierend und beschloss, mich zu bewerben. Als ich angenommen wurde, begann ich mit meiner Doktorarbeit und merkte schnell, wie sehr ich die Forschung und den Reiz von Entdeckungen liebte. Nach dem Abschluss meines PhDs habe ich im Ausland als Postdoktorandin geforscht. Zuerst ging ich in die USA an die Carnegie Institution – eine äusserst wertvolle Erfahrung. Danach zog ich nach Grossbritannien für eine weitere Postdoc-Stelle, bevor ich meine erste feste Stelle in Manchester annahm. Vor etwa zehn Jahren kehrte ich in die Schweiz zurück. Auf diesem Weg habe ich erkannt, dass meine wahre Berufung in der Wissenschaft in meiner tiefen Leidenschaft für Forschung und Entdeckung liegt. Ich habe sie Schritt für Schritt entdeckt. Meine Inspiration kam nicht von einer bestimmten Person oder einem Schlüsselmoment – es waren die einzelnen Fachgebiete selber, die nach und nach meine Freude geweckt haben. Es war immer eine von Neugier getriebene Reise und ist es immer noch als Wissenschaftlerin.
Was treibt Sie an und begeistert Sie am meisten an Ihrer Arbeit? Ich arbeite in der Planetenwissenschaft, und ich bin einfach fasziniert von Planeten. Ich kann nicht wirklich erklären, warum – es ist einfach ein Teil von mir. Gleichzeitig habe ich schon immer die Wissenschaft geliebt. Was mich wirklich antreibt, ist der Nervenkitzel der Entdeckung: neue Fragen zu erforschen, neuen Herausforderungen zu begegnen und Schritt für Schritt Fortschritte zu machen. Es ist unglaublich spannend, ins Unbekannte einzutauchen und etwas zu lernen, das vorher noch niemand wusste.
Und der aufregendste Moment in den letzten Jahren? In der Wissenschaft erfolgt der Fortschritt oft durch viele kleine Schritte, und für mich sind genau diese Momente die bedeutsamsten. Eine der aufregendsten Phasen war während meiner Postdoc-Zeit. Es war eine herausfordernde Zeit; ich arbeitete hart daran, eine analytische Technik zum Laufen zu bringen, damit ich endlich Meteorite messen und die Forschung voranbringen konnte. Als es schliesslich funktionierte und ich meine wissenschaftliche Arbeit im angesehenen Journal “Science” veröffentlichte, war das ein wirklich besonderer Moment. Für einen kleinen Fortschritt Anerkennung zu bekommen, fühlte sich unglaublich lohnend an. Doch diese Art von Anerkennung ist nicht das, was mich am meisten antreibt. Was mich wirklich motiviert, ist der Entdeckungsprozess – neue Fragen aufzudecken, neue Richtungen zu erforschen und bedeutungsvolle Beiträge zum Fachgebiet zu leisten, auch wenn sie klein sind. Als Wissenschaftlerin lernt man ständig: zuerst, indem man versteht, was bereits bekannt ist, und dann, indem man fragt, wie wir diese Grenzen verschieben und weiteren Fortschritt ermöglichen können. Diese kontinuierliche Reise finde ich am spannendsten.
Die aufregendste Entdeckung? Das ist eine schwierige Frage, aber ein Moment, der für mich heraussticht, ist ein Artikel, den wir veröffentlicht haben, in dem ich modelliert habe, wie und wann Wasser – und andere flüchtige Elemente – auf die Erde gekommen sind. Unsere Forschung zeigte, dass der Grossteil des Erdwassers bereits während der Entstehung des Planeten vorhanden war, eingeschlossen im Inneren, während die Erde wuchs. Als die Erde abkühlte, wurde das Wasser nach und nach freigesetzt, bildete eine Atmosphäre, einen Ozean und schuf die Grundlage für Leben. Die Vorstellung, dass die Bausteine des Lebens von Anfang an Teil der Erde waren, ist für mich unglaublich spannend.
Haben Sie einen Rat oder ermutigende Worte für andere Frauen, insbesondere für jene, die Wissenschaftlerinnen werden möchten? Es ist wichtig, etwas zu tun, das man liebt. Deine Leidenschaft sollte von innen kommen. Verfolge die Wissenschaft nicht, um den Erwartungen anderer zu entsprechen; tue es, weil es für dich stimmt. Wissenschaft kann schwierig sein, und du wirst auf Herausforderungen und Widerstände stossen. Aber wenn du offen und hartnäckig bleibst, entdeckst du oft neue Wege – manchmal sogar spannendere, als du zuerst gedacht hast. Es ist genauso wichtig, Grenzen zu erkennen und flexibel zu bleiben, um unerwartete Türen zu finden, die dich weiterbringen können. Wissenschaftlerin zu sein ist mehr als nur ein Beruf, es ist Berufung. Es ist etwas, für das man Leidenschaft haben muss, denn obwohl es kein „normaler“ Job ist, ist es unglaublich erfüllend – wenn es zu dir passt.Manchmal möchten Studierende oder Postdocs in der Wissenschaft, aber auch in der Schweiz bleiben, und das kann schwierig sein – es gibt einfach nicht so viele Stellen. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, in der Wissenschaft tätig zu sein, und alle können erfüllend sein. Es gibt mehr Chancen, als man vielleicht denkt.
Sind Frauen in der Wissenschaft aussergewöhnliche Frauen? Um ehrlich zu sein, denke ich nicht. Sie sind einfach ganz normale Frauen, die tun, was sie lieben. Frauen in der Wissenschaft könnten genauso gut Unternehmerinnen, Journalistinnen, Tierpflegerinnen oder etwas ganz anderes sein – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Was wirklich zählt, ist Leidenschaft. Diese Frauen brennen für die Wissenschaft, und genau das treibt sie an. Aber sie sind im Grunde nicht anders als alle anderen, die das verfolgen, was ihnen wichtig ist.
Was denkst du, ist der Hauptgrund für die Unterrepräsentation von Frauen in der Wissenschaft? Das ist ein schwieriges und komplexes Thema – deshalb ist es auch noch nicht wirklich gelöst, und wir müssen weiterhin daran arbeiten. Ich glaube, vieles hängt mit gesellschaftlichen Normen und Traditionen zusammen. Wir haben wichtige Fortschritte gemacht, um Frauen als gleichwertig mit Männern anzuerkennen, aber viele von uns, mich eingeschlossen, sind in Umgebungen aufgewachsen, in denen traditionelle Rollen noch die Norm waren – Männer arbeiten ausserhalb des Hauses, Frauen kümmern sich meist um Kinder und Haushalt. Auf gesellschaftlicher Ebene – besonders in Ländern wie der Schweiz – sind traditionelle Rollen tief verwurzelt, und es kann herausfordernd sein, aus diesen auszubrechen. Für viele, die mit traditionellen Vorstellungen von Mutterschaft aufgewachsen sind, kann die Entscheidung für eine Kinderbetreuung schwierig sein, selbst wenn sie sicher sind, dass ihr Kind gut versorgt ist und soziale Kontakte pflegt. Ich glaube, die Gesellschaft muss anerkennen, dass es viele Wege gibt, ein erfülltes Leben zu führen, und dass Kinder und zukünftige Generationen in Familien gedeihen können, die nicht unbedingt traditionellen Rollen folgen. Es geht darum, Vielfalt in unserem Leben und Arbeiten zu akzeptieren und veraltete Normen loszulassen.
Wie sieht es mit der neuen Generation aus? Verändert sich etwas? In der Schweiz sehe ich sowohl Fortschritte als auch Herausforderungen. Meine Generation hat den Wandel vorangetrieben – einige meiner Freundinnen hatten zum Beispiel Partner, die zu Hause geblieben sind, während sie gearbeitet haben – was zeigt, dass es vor allem darauf ankommt, das zu finden, was für jede Familie am besten funktioniert. Trotzdem stehen viele Menschen immer noch vor Schwierigkeiten, wenn sie Beruf und Kinder unter einen Hut bringen wollen. Der Zugang zu Kinderbetreuung ist eine grosse Hürde. Obwohl Männer Fortschritte dabei gemacht haben, Verantwortung zu teilen, fallen die Betreuungsaufgaben immer noch überwiegend auf die Frauen, die so oft stärker belastet werden. Die Gesellschaft muss sich weiterentwickeln, indem sie vielfältige Lebens- und Arbeitsmodelle anerkennt und den Schwerpunkt von traditionellen Rollen hin zu einem unterstützenden Familiensystem verlagert.
Was bedeutet Erfolg für Sie? Wie definieren Sie persönlichen Erfolg in Ihrem Beruf oder im Leben? Für mich hängt Erfolg davon ab, was einem persönlich wichtig ist und wie gut man danach leben kann. Obwohl ich traditionelle Rollen kritisch reflektiere, erkenne ich auch an, dass es für viele Menschen erfüllend ist, eine Familie zu haben und sich darauf zu konzentrieren – und sie darin wahres Glück und Erfolg finden. Für mich bedeutet Erfolg, was einen als Individuum zufriedenstellt. Natürlich misst die Gesellschaft bestimmten Rollen, wie der einer Professorin, oft mehr Wert bei, aber das sollte nicht die Definition von Erfolg sein. Echter Erfolg ist, ob ich das Leben führen kann, das ich leben möchte.
Welche Anstrengungen und Opfer bringen Sie für die Wissenschaft? Ich arbeite viele Stunden – so viele, dass ich sie gar nicht mehr genau zähle. Aber wenn man von Leidenschaft erfüllt ist und sich durch die Arbeit energiegeladen fühlt, ist das völlig in Ordnung. Der Schlüssel liegt darin, Zufriedenheit und Balance zu finden, wobei diese Balance sehr persönlich und für jeden anders ist. Das ist eine der Herausforderungen heute, besonders für die jüngere Generation: Bei so vielen Möglichkeiten ist es nicht immer einfach herauszufinden, wo man wirklich hingehört. Als ich zwanzig war, wusste ich auch nicht genau, welche Talente oder Bedürfnisse ich hatte. Man muss ausprobieren, Erfahrungen sammeln und manchmal scheitern, um zu erkennen, was das Richtige für einen ist – und das ist okay. Scheitern ist ein Teil des Erfolgs.
Was sind Ihrer Meinung nach die grössten Herausforderungen für die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen? Die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen steht vor vielen Herausforderungen. Obwohl Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung erzielt wurden, gibt es unbewusste Vorurteile (unconscious bias), deren man sich bewusst sein muss. Früher mussten Frauen härter arbeiten, um Anerkennung zu bekommen, auch wenn das nicht immer offen anerkannt wurde. Ein faires und inklusives Umfeld bedeutet, dass Frauen etwa 30-40 % der Wissenschaftsgemeinschaft ausmachen sollten. Liegt der Anteil darunter, werden Frauen oft als Minderheit wahrgenommen, als Frau und nicht als Wissenschaftlerin; oberhalb dieser Schwelle gelten sie als gleichwertige Mitglieder und Wissenschaftlerinnen. Viele Institutionen legen heute Wert darauf, qualifizierte Frauen einzustellen, was manchmal bei Männern, die um begrenzte Stellen konkurrieren, Frustration auslösen kann. Es ist wichtig, diese Ungleichheiten sorgfältig anzugehen, ohne dabei starke Ungerechtigkeiten gegenüber einem Geschlecht zu schaffen. Nach Jahren der Benachteiligung ist die Unterstützung von Frauen gerechtfertigt, aber zu starker Druck kann Gegenreaktionen hervorrufen.
Ist Ihnen Geschlechtervielfalt in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit wichtig? Welchen Wert sehen Sie in Vielfalt innerhalb der Wissenschaft? Für mich geht es grundsätzlich um Vielfalt. Vielfalt bringt eine grössere Bandbreite an Sichtweisen mit sich, was letztendlich die Qualität der Wissenschaft verbessert. Wenn man nicht in seiner eigenen kleinen Ecke feststeckt, gewinnt man eine breitere Perspektive. Gleichzeitig kann Vielfalt auch Herausforderungen mit sich bringen – kulturelle Unterschiede, Generationsunterschiede, Geschlechterperspektiven – und es erfordert Arbeit, alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Dieser Prozess basiert auf Respekt: Respekt vor Unterschieden und Wertschätzung der einzigartigen Perspektiven jedes Einzelnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Vielfalt ein Gewinn ist. Studien zeigen, dass echte Vielfalt zu besseren Ergebnissen führt, und ich sehe das auch in der wissenschaftlichen Arbeit bestätigt.
Bringen Männer und Frauen unterschiedliche Perspektiven oder Sensibilitäten in die wissenschaftliche Arbeit ein? Ich denke, es gibt einige geschlechtsspezifische Unterschiede, aber es ist schwer, das auf individueller Ebene zu verallgemeinern. Statistisch arbeiten Frauen oft still und ohne Selbstpromotion, was in der Wissenschaft ein Nachteil sein kann. Sie neigen auch dazu, mehr Wert auf Teamarbeit zu legen. Natürlich gibt es Ausnahmen sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Als ich ein nationales Gender-Programm leitete, bin ich auf viel Unbehagen bezüglich der Einordung in Stereotypen gestossen. Niemand passt genau in eine Schublade, und es ist wichtig, auch die Vielfalt innerhalb einer bestimmten Gruppe anzuerkennen. Am Ende ist es am besten, diese Unterschiede als statistische Tendenzen zu betrachten und sich auf Daten zu konzentrieren, um breite Verallgemeinerungen zu vermeiden.
Wie ist Ihre Meinung zu Programmen für Diversität und Inklusion und deren Wirksamkeit? Wir sind noch nicht am Ziel – zumindest nicht in der Schweiz. Echter Wandel wird weitere 10 bis 20 Jahre dauern, und ich bleibe vorsichtig optimistisch, aber nur, wenn wir weiter daran arbeiten. Manchmal denken die Leute: „Wir haben ein paar Professorinnen eingestellt, also ist das Problem gelöst.“ Aber das stimmt so nicht. Fortschritte können leicht ins Stocken geraten. Wir beobachten immer noch Muster, bei denen Frauen zögern, sich auf Stellen zu bewerben, wenn sie nicht 100 % der Kriterien der ausgeschriebenen Stelle erfüllen, während Männer oft schon bei 80 % eine Bewerbung einreichen. Das Bewusstsein über diese Unterschiede ist wichtig. Deshalb sind Programme für Gleichberechtigung und Diversität nach wie vor notwendig. Sie helfen, das Bewusstsein zu bewahren und sicherzustellen, dass wir vorwärts und nicht rückwärts gehen.
Was halten Sie von intersektionalen Stereotypen? Unbewusste Vorurteile beginnen oft beim Geschlecht, werden aber komplexer, wenn weitere Identitätsaspekte hinzukommen – zum Beispiel, wenn man eine Frau ist, schwarz, und einer anderen Religion angehört oder als internationale Studentin in der Schweiz lebt. Jede zusätzliche Ebene kann die Herausforderungen verstärken, besonders wenn man mehreren Minderheitengruppen angehört. Aber Selbstvertrauen ist entscheidend. An sich selbst und das Recht, da zu sein, wo man ist – aufgrund der Ausbildung und eigenen Leistung – zu glauben, kann es erleichtern, Herausforderungen zu meistern und diejenigen zu ignorieren, die einen aufgrund der Minderheitzugehörigkeit infrage stellen. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, aber Selbstvertrauen kann als eine Art Schutz wirken.